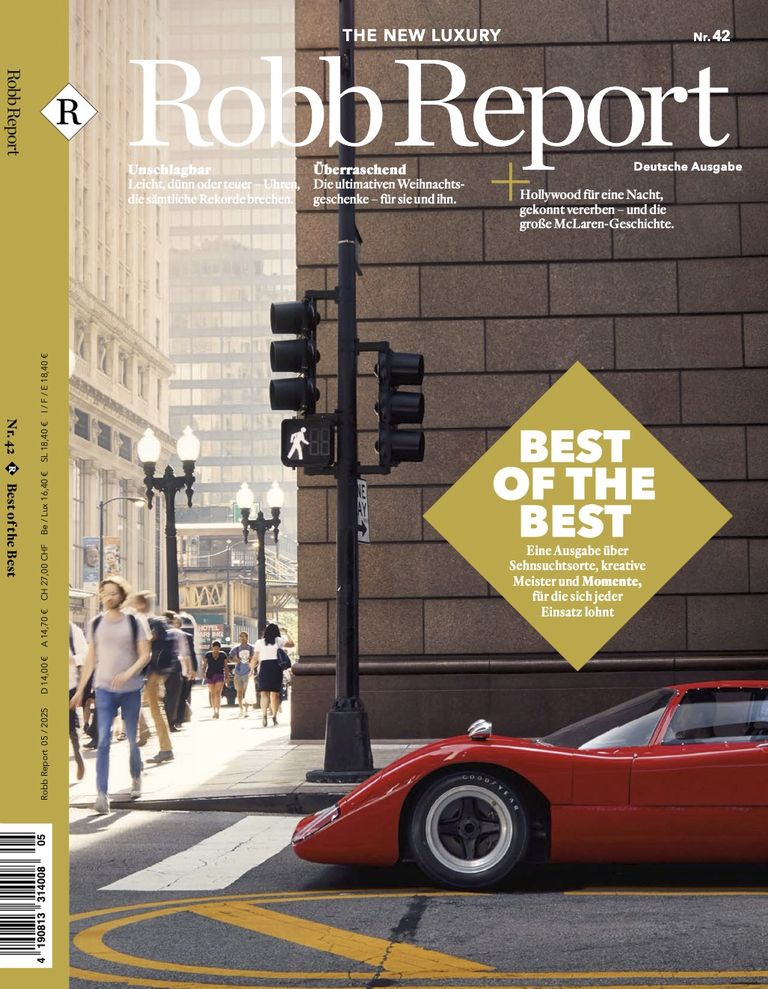Der große Unbekannte
Das Treffen findet über Zoom statt. Digital, anonym, aber die einzige Chance. Den Deutschlandchef des Guide Michelin überhaupt für ein Interview zu bekommen, ist bereits eine kleine Sensation. Es gibt Gerüchte über die Identität des Mannes auf der anderen Seite des Monitors. Alles Gerüchte. Aber fest steht: Michelin ist nicht nur der größte Reifenhersteller der Welt, sondern kuratiert auch 2025 mit einer Idee aus dem frühen 20. Jahrhundert die Spitzengastronomie. Ein Stern mehr oder weniger kann über Aufstieg oder Niedergang entscheiden. Der Direktor führt ein Team von Inspektoren an, und er testet auch selber. Für unser Gespräch nennt er sich Jan Werner. Kein Gesicht, nur eine schwarze Kachel.
Ihr richtiger Name ist nicht Jan Werner. Warum verstecken Sie sich?
Weil sich in den sozialen Medien sehr viele Informationen immer schneller verbreiten. Für uns ist es wichtig, gerade für mich als Direktor, dass wir unsere Arbeit unabhängig machen können. wenn man wüsste, wer ich bin, würden mich Küchenchefs ansprechen und fragen, wie der Stand ist. Das wollen wir vermeiden. Deshalb die Vorgabe aus unserer Zentrale aus Paris: Anonymität.
Funktioniert es oder sind Sie schon einmal aufgeflogen?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Glauben Sie, dass Sie selbst einen Tester erkennen würden?
Jeder Gast könnte ein Tester sein.
Abgesehen von wenigen Eingeweihten sind sie also der große Unbekannte.
Klar, meine Frau, meine Familie, ein paar Freunde wissen Bescheid. Aber wir sind hier jetzt auch nicht beim Geheimdienst. Ich setze mir keine Brille auf, klebe mir keinen Bart an. Unsere Arbeitsweise ist sachlich. Der Gaumen entscheidet.
Champagner oder Rum?
Champagner.
Spiegelei oder Rührei?
Kommt auf die Gefühlslage an. Ein Rührei ist natürlich flexibler, aber ein Spiegelei kann auch schön sein, vor allem, wenn man es in ein Sandwich einbaut und es noch einen schönen laufenden Dotter hat.
Wie oft sind Sie zum Testen unterwegs?
Meine Mitarbeiter, wir nennen sie Inspektoren, machen 250 bis 300 Essen pro Jahr. Bei mir sind es um die 150. Wir sind dann „auf Tour”, wie wir sagen.
Welche Charaktereigenschaften braucht es, um es zum Direktor des Michelin Guide zu bringen?
Integrität gehört dazu. Verschwiegenheit, Belastbarkeit. Und vor allem Selbstdisziplin. Weil man sehr viel und sehr lange alleine unterwegs ist.
Kennen Sie die Memoiren von Keith McNally, dem legendären New Yorker Gastronomen, der das Balthazar oder das Pastis betrieben hat?
Nein.
Er schreibt, dass seine Sympathie jenen verloren wirkenden Gästen galt, die alleine speisten – und zur Aufmunterung ein Glas Champagner von ihm aufs Haus bekamen.
Gefällt mir! Eine schöne Geste. Wäre bei mir, wenn ich Gast bin, aber tabu.
Ist es ein Traumberuf, Luxusrestaurants zu testen?
Für mich ist es das. Man geht aber nicht nur ein bisschen essen, schreibt was und gut ist's. Die Tage sind lang. Dazu gehören Recherchen, Planungen, Abrechnungen. Und das Essen an sich ist ja auch ein anderes, als wenn ich jetzt mit Ihnen mittags essen gehen würde und wir würden das einfach genießen. Man isst sehr bewusst, schmeckt sehr bewusst, man achtet auf Details – und muss später alles im Kopf abrufen, weil wir uns keine Notizen machen, wie manche glauben. Da liegen kein Stift und kein Block auf dem Tisch.
Ist das Männersache? Ein Männertraumjob?
Nein. Global sind auch Frauen bei uns im Team. Zu den genauen Verteilungen kann ich offiziell nichts sagen. Das sind interne Daten.
Eines der wenigen Dinge, die man über Sie weiß: Sie kommen selbst aus der Spitzengastronomie. Es scheint doch eine von Männern dominierte Branche zu sein. Oder täuscht das?
Ich persönlich würde mir wünschen, dass es mehr Köchinnen gibt, die den Weg in die Spitzengastronomie finden. Unser Job ist es, die Qualität auf den Tellern zu bewerten. Da spielt das Geschlecht keine Rolle. Warum weniger Frauen den Beruf machen, das müsste vielleicht ein Soziologe beantworten.
Als Direktor können Sie uns aber bestimmt die Sterne deuten: Erklären Sie doch bitte mal, wie das Sterne-System funktioniert.
Ein Stern ist ein Stopp wert. Zwei Sterne: Es lohnt sich, einen Umweg zu fahren. Drei Sterne: Das Restaurant ist eine eigene Reise wert. Das ist der Ursprung, und das gilt immer noch. Die Gebrüder Michelin hatten in der Zeit des aufkommenden Automobils einen Routenführer entwickelt, mit Hinweisen, in welcher Apotheke man Benzin kaufen kann, wo es eine Werkstatt gibt. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass die Leute, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, Reifen brauchen, die sie bei der Firma Michelin kaufen können. Als zusätzlicher Anreiz wurden bald auch Restaurants empfohlen …
… und Sterne vergeben …
… exakt. Dieses Sterne-System gab es in Frankreich erstmals 1926. Dann, seit 1966, auch in Deutschland. Und inzwischen weltweit in über sechzig Destinationen.
Wie werden die Sterne vergeben? Sie sind auf Tour, die Inspektoren sind auf Tour. Und dann?
Eine Testsaison dauert bei uns ein Jahr. Da gehen wir essen. Das muss nicht unbedingt ein Kalenderjahr sein. Wir sagen dazu Guide-Jahr. In Deutschland kamen die neuen Auszeichnungen, für uns sind das die Selektionen, zum Beispiel im Juni heraus. Kurz vor Ablauf dieses Guide-Jahres treffen wir uns alle – die Inspektoren, die internationalen Koordinatoren und der Direktor – zur Sterne-Konferenz. Die heißt wirklich so, in allen Ländern. Wir diskutieren intensiv über die Vergabe und Streichung von Sternen.
Und wenn die Meinungen auseinandergehen?
Dafür gibt es ein extra Zeitfenster. Dann schicken wir noch mal jemanden hin. Vielleicht sogar einen Kollegen aus dem Ausland, um noch mal eine ganz andere Stimme zu hören. Es ist durchaus schon passiert, dass Kollegen aus den USA für drei Tage eingeflogen sind, um eine Entscheidung zu bestätigen. Oder es heißt: Huh, wir brauchen nächste Woche in London noch eine Meinung! Dann wird gekuckt, wer Zeit hat, und man fliegt hin.
Wie geht es einem, wenn man einem Koch einen bestehenden Stern nicht mehr gibt? Das kann für ein Restaurant das Ende sein.
Natürlich ist es nie leicht schwere Entscheidungen zu treffen – wie überall ist dies allerdings auch manchmal bei uns unumgänglich. Wir müssen uns immer bewusst sein für wen unsere Empfehlungen sind: für die Gäste.
Die Sterne sind der Goldstandard. Trotzdem gibt es Menschen, die noch nie in einem Sternerestaurant waren. Haben Sie eine Handreichung?
Ich würde sagen, locker angehen und einfach machen! Es ist ja keine Reise zum Mond. Ich will jetzt nicht das Klischee vom Casual Dining bemühen, aber der Trend geht zum Legeren. Die Krawatte können Sie zu Hause lassen. Wenn einem die gehobene Gastronomie nicht so vertraut ist, ist jetzt vielleicht nicht jeder Dreisterner passend. Wie beim Autofahrenlernen: nicht gleich in die Formel 1 setzen, sondern mit etwas Kleinerem beginnen und seinen Spaß finden. Es kann einen natürlich auch mal überfordern, je nachdem, was da für Aromen kommen. Deshalb ist eine gute Idee: mal ein Mittagsmenü probieren mit drei oder vier Gängen, statt mit acht oder zehn am Abend.
Wie ist das bei Ihnen – lassen Sie sich überhaupt noch beeindrucken?
Weniger leicht. Das ist auch gut so. Wenn ich, sagen wir, ein weltweit serviertes Gericht wie den Steinbutt schon 150 mal hatte, in L. A., in der Bretagne, in Tokio, dann ist das was anderes als bei einem Gast, der ihn noch nicht so oft probiert hat. Wir sind anders zu beeindrucken. Da geht es gar nicht mal um sogenannte Topprodukte. Schon eine Karotte, vom Garten nebenan, kann toll sein, je nach Machart.
Oder aber Kreationen von Häusern wie dem El Bulli in Barcelona oder dem Noma in Kopenhagen, wo die Grenzen zwischen Küche und Kunst fließend werden.
Das sind natürlich zwei Richtungen, die um die Welt gegangen sind und die Küche sehr stark beeinflusst haben. Die Tiefe, in die Ferran Adrià da eintaucht mit seinen Laboren, die ist eigentlich nur ihm zugänglich. Am Ende vom Tag kommt es aber für uns auf den Geschmack an. Das muss einfach Sinn ergeben, harmonisch sein: die Abstimmung, das Handwerk, im Einklang mit unseren Kriterien. Die flüssige Olive von Ferran Adrià – feste Haut, flüssiger Kern – ist genau das.
Für die andere Richtung, raus aus den Laboren, rein in den Wald, steht das Noma, das manchen über viele Jahre als bestes Restaurant der Welt galt. Waren Sie mal dort?
Ja. Sehr interessant. Man kommt an einem Gewächshaus an. Die Gäste treffen gleichzeitig ein und werden abgeholt. Ein erster Aperitif, vorbei an Pflanzenwelten geht es dann zu diesem modernen Bau. Sehr spezielles Menü, auf die Saison abgestimmt: Foraging – die Köche sammeln die Zutaten selber. Algen, Gewächse vom Strand, Pilze aus dem Wald, Moos, solche Dinge. Das ist ein spezielles Erlebnis, und das Noma bekam dann ja auch drei Sterne – weil es eine eigene Reise wert ist.
Es soll Leute geben, die auf hohem Level kochen – sich aber dem Druck nicht aussetzen wollen. Manch einer hat einen Stern sogar abgelehnt! Wie gehen Sie mit Kritik am Sterne-System um?
Das Prinzip, nach dem wir arbeiten, beruht darauf, dass wir eine Meinung abgeben – zu öffentlich zugänglichen Restaurants. Wie auch jeder andere, der das möchte, online seine Meinung äußern kann. Ich glaube eben nur, dass wir es ein bisschen stilvoller tun. Wir schreiben keine negativen Berichte, publizieren keine schlechten Erfahrungen. Sondern berichten nur positive Dinge. Ja, die Sterne haben eine Strahlkraft. Und ich glaube, das kann in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Hilfe für Gastronomen sein. Wir tun es aber nicht für die Dankbarkeit der Köche, sondern im Grunde arbeiten wir für die Gäste. Wenn nun jemand enttäuscht ist, hat das meist mehrere Gründe. Das liegt nicht immer nur am Stern alleine.
Aber Sie haben Verständnis dafür, wenn jemand nicht an diesem System teilhaben möchte.
Natürlich. Wir verlangen von niemandem, etwas Bestimmtes zu tun oder zu kochen. Das wird manchmal nicht verstanden. Der Stern kommt ja für das, was jemand tut. Wenn daraus ein Stern resultiert, dann ist das so. Alles andere ist Sache der Köche oder der Gastronomen.
Es ist immer wieder von Krise die Rede, gerade in der Spitzengastronomie. Andererseits gab es etwa in Deutschland noch nie so viele Sternerestaurants wie in diesem Jahr. Wie passt das zusammen?
Wir bewerten nur einen sehr kleinen Kreis der Gastronomie. Dass es der Branche nicht perfekt geht, ist kein Geheimnis. Wir sind aber keine Wirtschaftsprüfer. Wie ein Restaurant finanziert wird, spielt für uns keine Rolle. Die Wahrheit liegt für uns nur auf dem Teller. Dennoch sehen wir, dass trotzdem vor allem junge Köchinnen und Köche den Schritt wagen. Was auch sehr oft funktioniert. Wir können nicht den Trend erkennen, dass die Sternegastronomie rückläufig ist.
Welche Rolle spielen Ihre Restaurantbesuche für das eigene Kochen? Inspiriert Sie das?
Ja, natürlich. So etwas wie Garnelen mit Limette und Grapefruit, sauber mariniert mit Olivenöl, das gab es neulich auch bei uns. Oder Klassiker, die einen an die Kindheit erinnern – und mit denen man Emotionen verbindet. Da freut man sich, dass man das wieder schmecken darf. Vielleicht sogar mit besseren Garstufen als früher bei der Oma.
Großmütter – sind die nicht auf ihre ganz eigene Art Spitzenköchinnen?
Absolut. Die Oma ist für jeden Einzelnen immer noch der beste Koch. Weil sich Erinnerungen, Aromen, Emotionen verbinden. Und wenn Köche es vermögen, Emotionen zu reproduzieren und bei ihren Gästen zu wecken, dann ist das genau das, was eine tolle Küche ausmacht. Und über die reine Nahrungsaufnahme weit hinausgeht. Man könnte sich ja immer auch irgendwo ein Sandwich holen, und ich will das gar nicht schlechtmachen, das kann auch toll sein. Aber es ist natürlich was anderes, wenn es einem Koch gelingt, mit Aromen und Emotionen zu spielen.
Haben Ihre Kinder auch schon einen besonderen Sinn für Aromen?
Sie sind auf jeden Fall neugierig. Einmal, vor zwei Jahren im Urlaub, sind wir im Supermarkt an einer Fischtheke vorbeigelaufen. Da hat mein Sohn, mit sechs Jahren, auf die Theke gedeutet und gefragt: „Was ist das? Austern? Ja, das will ich probieren!“ Fand ich gut, hat er gemacht. Ob er dann so happy damit war, weiß ich nicht. Ich glaube, das Geschmackserlebnis hat sich eingebrannt und vielleicht kommt es irgendwann zurück. Er hat sie jedenfalls nicht ausgespuckt.